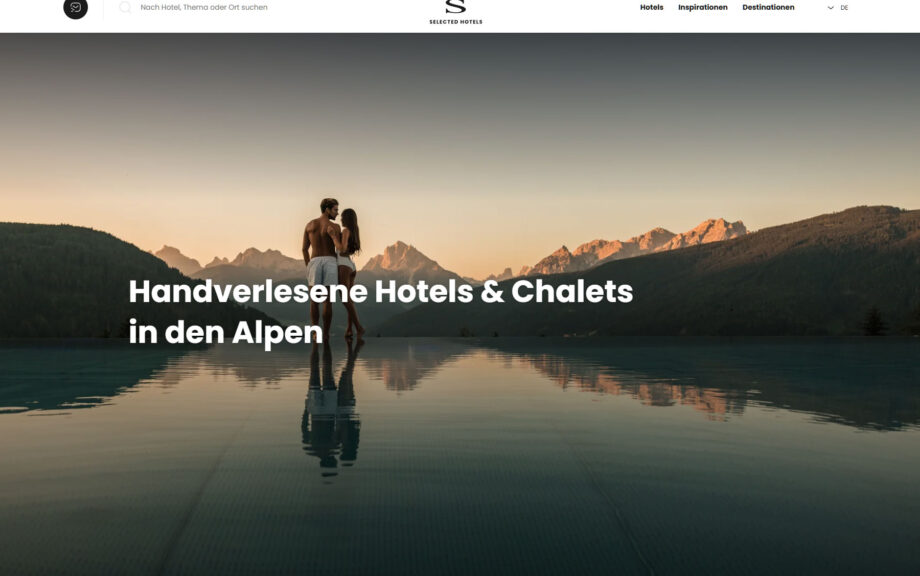Die Weißkugelhütte ist eine Schutzhütte im hinteren Langtauferer Tal. Sie ist auch unter dem italienischen Namen Rifugio Pio XI alla Palla Bianca bekannt, benannt nach Papst Pius XI. Die Hütte liegt gegenüber den Gletschern und Moränen der Weißkugelgruppe auf der Südseite des Langtauferertals. Von hier aus ist allerdings nur der Gipfel der Weißkugel sichtbar, der sich hinter dem Bärenbartkogel erhebt.
Titelbild: Es kommt sehr selten vor, dass ein Bild in diesem Wanderblog nicht von uns selbst ist. In diesem Fall stammt das Titelbild von Noclador – Wikipedia, Lizenz: CC BY SA 3.0.
Lage der Schutzhütte
Die Weißkugelhütte thront in einer beeindruckenden Hochgebirgslandschaft im hinteren Langtauferer Tal. Von der Hütte aus sieht man die Moränenlandschaften des Langtauferer Ferners sowie umliegende Gipfel wie Bärenbartkogel, Weißkugel und Langtauferer Spitze. In der Umgebung erheben sich zahlreiche hohe Gipfel wie die Weißkugel (3739 m), die Weißseespitze (3526 m) und die Langtauferer Spitze (3529 m). Auch der Bärenbart (3553 m), die Saldurspitze (3433 m), die Schwemser Spitze (3459 m) und die Oberettesspitze (3459 m) sind von hier aus erreichbar. Auch die Saldurseen, das höchstgelegene Seenplateau Südtirols, sind nicht weit entfernt. Mittlerweile liegt die Hütte auch in der Nähe der Schnalstaler Gletscherbahnen, deren Liftanlagen am Hochjochferner allerdings nicht direkt bis zur Hütte führen.
Geschichte der Weißkugelhütte
Bereits 1888 gab es Pläne des Österreichischen Touristenklubs, an dieser Stelle eine Hütte zu errichten, die aber wieder verworfen wurden. 1889 zeigte die DuÖAV-Sektion Düsseldorf Interesse, konnte sich aber mit dem ÖTK nicht einigen. Schließlich erwarb 1891 die DuÖAV-Sektion Frankfurt a. M. den Bauplatz, deren Vorstand Dr. Petersen von dieser Seite einen Durchstieg zur Weißseespitze erkannte. Die Bauarbeiten begannen 1892, die feierliche Einweihung fand am 12. Juli 1893 statt. Die Feierlichkeiten begannen bereits am 10. Juli in Landeck, es folgten große Empfänge in Prutz, Pfunds, Nauders und Graun. Zu Fuß marschierte die Festgesellschaft durch das Langtauferer Tal zur Hütte, wo die Einweihung mit Böllerschüssen, Ansprachen und einem ausgiebigen Frühstück gefeiert wurde. Die ursprüngliche Hütte war ein kleiner, rundherum verschindelter Holzbau mit einem Vorraum, der auch als Führerraum mit Herd diente, einem Aufenthaltsraum, zwei Schlafräumen für je acht Personen und einem Dachboden mit Heulager für 15 bis 18 Personen. Eine nahe gelegene Quelle lieferte ausgezeichnetes Trinkwasser. Ab 1897 wurde die Hütte nicht mehr bewirtschaftet und nach dem Pott-System versorgt.
1910 ging die Hütte durch Kauf an die Sektion Mark Brandenburg (Berlin) über. 1911 erhielt sie mit dem pensionierten Bergführer Kotter aus Ridnaun erstmals einen Hüttenwirt, der für Sauberkeit und Proviant sorgte. 1912 kam eine weitere Person als Köchin, Kellnerin und Putzfrau hinzu. Nach dem Ersten Weltkrieg ging die Hütte 1919 in den Besitz des italienischen Staates über. 1923 wurde sie von der Hüttenkommission des CAI übernommen, später von der Sektion Desio des CAI, die sie nach ihrem berühmtesten Mitglied, Papst Pius XI. benannte (Rifugio Pio XI). Im Jahr 1936 wurde die Hütte durch einen gemauerten Anbau auf die heutige Größe erweitert. Sie erhielt eine neue Küche, eine holzgetäfelte Gaststube und Platz für weitere 30 Schlafplätze. 1963 errichtete der Langtauferer Bergführer Hohenegger, der die Hütte seit 1925 bewirtschaftete, mit finanzieller Unterstützung der CAI-Sektion Desio eine kleine Kapelle in der Nähe der Hütte. Von 1964 bis 1970 war die Hütte vom italienischen Staat beschlagnahmt und militärisch besetzt. 1972 baute der Pächter mit eigenen Mitteln eine Materialseilbahn. Seit 1971 ist die Hütte wieder durchgehend bewirtschaftet.
Wanderung zur Hütte und Tourenmöglichkeiten ab der Hütte
Die Weißkugelhütte erreicht man auf zwei Hauptwegen von Melag im Langtauferer Tal (1915 m):
- Auf dem Weg Nr. 2 taleinwärts und in Serpentinen hinauf zur Hütte benötigt man ca. 2 Stunden.
- Landschaftlich schöner ist der Aufstieg auf dem Weg Nr. 1 nordwärts, dann über eine Brücke über den Melagbach und weiter auf dem Weg Nr. 3, der fast eben zur Hütte führt. Für diese Variante benötigt man ca. 2 ¾ Stunden.
Die Weißkugelhütte ist ein wichtiger Stützpunkt für anspruchsvolle Hochtouren:
- Weißseespitze (3526 m): Ein markanter Firngipfel nördlich der Hütte. Der Aufstieg erfolgt über den oberen Steig taleinwärts zu den Eisbrüchen, durch die Felsen der Vernaglwände und über den flachen Gepatschferner nordwärts zum Gipfel. Für Geübte ist diese Tour nicht schwierig und dauert etwa 3 ½ bis 4 Stunden.
- Weißkugel (3739 m): Der zweithöchste und einer der schönsten Gipfel der Ötztaler Alpen. Die Route führt über die Randmoräne zum Langtauferer Ferner, über diesen zum Weißkugeljoch (3354 m) und weiter über den Ostnordostgrat (anspruchsvoll, brüchiges Gestein) zum Gipfel. Die Gehzeit beträgt 4 bis 4 ½ Stunden. Beachte, dass dies nicht der Normalweg zur Weißkugel ist. Die Weißkugel zählt zu den am häufigsten bestiegenen Gipfeln der Ötztaler Alpen.
- Langtauferer Spitze (3529 m): Ein breiter Gipfel nordöstlich der Weißkugel. Vom Weißkugeljoch (siehe Weißkugel) erreicht man den Gipfel über den Südwestgrat (Vorsicht Schneewechten!) in ca. 1 Stunde. Die Gesamtgehzeit von der Hütte beträgt 3 bis 3 ½ Stunden.
- Eine kombinierte Runde mit landschaftlicher Vielfalt bietet sich durch Aufstieg über Weg Nr. 1/3 und Abstieg über Weg Nr. 2 an.
Von der Weißkugelhütte ist auch eine hochalpine Überschreitung ins Laaser Tal möglich. Die Besteigung der Finailspitze ist auch über das Hochjoch von der Weißkugelhütte erreichbar, jedoch deutlich weiter als vom Schnalstal. Durch die gletscherfreie Verbindung aus dem Langtauferer Tal über das Matscher Joch ist eine Hüttenwanderung zur Weißkugelhütte möglich.
Übernachtung und Ausstattung der Weißkugelhütte
Die Weißkugelhütte verfügt über 4 Betten und 40 Matratzenlager. Die Beleuchtung erfolgt über ein eigenes Stromaggregat, fließendes Wasser ist vorhanden. Es gibt keinen Winterraum.
Die Hütte ist in der Regel von Mitte Juli bis Mitte September bewirtschaftet.
Bei vorheriger Anmeldung ist eine Frühjahrsöffnung von Ostern bis Ende Juni möglich, vor allem für Skitourengruppen.